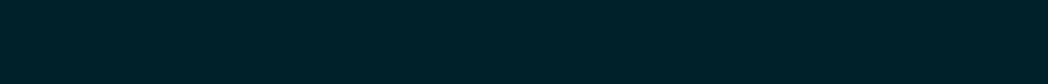Die Antwort darauf scheint für Schröder klar zu sein. „Ich werde in diesem Land nicht die gleiche Liebe bekommen, weil ich dunkelhäutig bin“, sagte er im Gespräch mit dem Stern. Die Rolle als Fahnenträger bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris – für Schröder ein Traum seit Jugendtagen – sei zwar eine Ehre gewesen, doch niemals mit dem Jubel vergleichbar, den Nowitzki 2008 in Peking erfuhr.
Doch wer die geringere Wertschätzung für Schröder allein mit seiner Hautfarbe erklärt, greift deutlich zu kurz. Vielmehr treffen hier zwei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinander.
Nowitzki: Superstar ohne Allüren
Dirk Nowitzki ist als Basketballer bekannt geworden, ist dem Status als reiner Sportler aber längst entwachsen. Der Würzburger gewann 2011 mit den Dallas Mavericks die NBA, schrieb als MVP Geschichte und revolutionierte das Spiel der Big Men.
Doch mindestens ebenso prägend war sein Auftreten: bescheiden, humorvoll, bodenständig. Nowitzki verzichtete in Dallas auf Millionen, teilte lieber Trainingsvideos als Bilder von Luxusautos und wurde so zur Projektionsfläche für den „Star ohne Allüren“.
Nach der Karriere engagiert er sich als Kurator einer eigenen Stiftung für benachteiligte Kinder, seine selbstironischen Werbeauftritte für eine große Bank sind wohl jedem in Deutschland bekannt.
Seine Bodenständigkeit machte ihn nicht nur zu einem der größten Spieler seiner Zeit, sondern sowohl in den USA als auch in Deutschland zu einem Volksidol – ein „Saint Dirk“, den Fans und Medien gleichermaßen lieben.
Schröder: Leistungsträger mit Ecken und Kanten
Schröders Karriere verlief weniger gradlinig. Zehn NBA-Teams in zwölf Jahren, ein permanentes Wandeln zwischen Glanzmomenten und Kritik. Schauen wir alleine auf die Erfolge in den USA, schlüge das Pendel deutlich in Richtung Nowitzki aus: NBA-Ring, MVP-Auszeichnung, 14 All-Star-Game-Teilnahmen. Bei Schröder steht nach 12 Saisons in der besten Basketball-Liga der Welt in all diesen Kategorien die Null.
Gleichzeitig ist Schröders sportlicher Wert für die Nationalmannschaft unbestritten. Als Kapitän führte er Deutschland 2023 zum ersten WM-Titel – ein Erfolg, der auch dem großen Dirk Nowitzki nie gelungen war. Außerdem wurde Schröder MVP des Turniers und prägt das DBB-Team wie kaum ein anderer. Weltmeistertrainer Gordon Herbert forderte damals zurecht: „Es ist an der Zeit, dass wir ihm in Deutschland 100 % Respekt zollen.“
Auch abseits des Feldes stellt sich der Braunschweiger Schröder anders dar als sein großer Vorgänger: Luxusautos, Villen und eine hautnahe Begleitung via eigenem Youtube-Kanal. All das passt für viele Fans nicht ins deutsche Bild eines „Bodenständigen“. Schröder selbst sagt heute: „Ich habe Fehler gemacht, ich bin nicht perfekt.“
Dabei tappt der 31-Jährige in eine Falle, die Social Media so vielen Menschen stellt. Als Creator will Schröder ein bestimmtes Bild von sich aussenden, doch wie die Videos letztlich bei den Fans ankommen, kann er nicht kontrollieren. Das Bild des erfolgreichen Emporkömmlings und kümmernden Familienvaters auf der einen, des unselbstständigen und auf Luxus fixierten Privilegierten auf der anderen Seite: Was der Zuschauer daraus macht, bleibt ihm selbst überlassen.
Zwei Karrieren, zwei Geschichten
Der Vergleich zwischen Nowitzki und Schröder hinkt also nicht nur wegen der unterschiedlichen Spielpositionen. Während Nowitzki für Treue und Kontinuität und Bodenhaftung steht, verkörpert Schröder Wandel, Selbstbehauptung und den Versuch, mit Vorurteilen zu brechen. Beide haben dem deutschen Basketball historische Momente geschenkt – doch die Wahrnehmung ist eine andere.
Wenn Schröder das deutsche Team aufs Feld führt, geht es nicht nur um Erfolg auf dem Court. Es geht auch um Anerkennung. Die sportliche hat er sich längst verdient. Ob ihm auch die emotionale Verehrung zuteilwird, die Nowitzki genießt, bleibt offen. Schröder selbst scheint nicht daran zu glauben.
Zum Match-Center: Deutschland vs. Slowenien