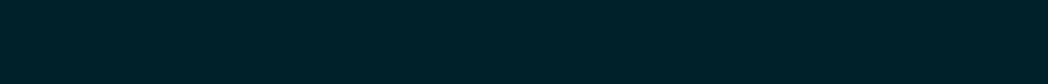8:6 Siege, zuletzt der ungefährdete Erfolg bei den Trail Blazers am Dienstagabend. Die Suns, die eigentlich in den Abgrund rutschen sollten, sind plötzlich eines der spannendsten Teams der NBA. Wie konnte es dazu kommen und wie nachhaltig ist dieser Trend?
Die Abgänge von Durant und Beal hinterließen zwar klare Offensivlücken, aber sie beseitigten auch ein grundlegendes strukturelles Problem: Alle drei Stars – Durant, Beal und Devin Booker – sind ausgezeichnete Scorer, aber bringen wenig in den Bereichen Playmaking, Spacing, Perimeter-Defense oder Rim Protection. Eine solche Konstellation ist schwer auszubalancieren, vor allem da keiner dieser Stars in der Crunch-Time auf der Bank sitzen kann.
Ohne Durant und Beal öffneten sich jedoch wertvolle Rotationsplätze für vielseitige Spieler wie Grayson Allen, Royce O'Neale, Collin Gillespie, Ryan Dunn, Jordan Goodwin, Oso Ighodaro und Nick Richards. So war es Gillespie, der als Vertreter der "neuen" Suns in Portland hervortrat und 19 Punkte beisteuerte – genauso viele wie Superstar Booker.
Zusätzlich verpflichteten die Suns Dillon Brooks, Jalen Green (der aufgrund einer Oberschenkelverletzung noch limitiert ist) und Mark Williams. Keiner dieser Spieler ist ein natürlicher 20-Punkte-Scorer. Doch sie füllen die Lücken, die das Team zuvor schwächten: defensive Variabilität, Athletik, Rebounding, Spacing und Rollenspielerqualitäten.
Elite-Spacing als Schlüssel zum Erfolg
Schon vergangene Saison waren die Suns ein ordentliches Dreierteam, doch 2025/26 haben sie sich in dieser Disziplin nochmal klar gesteigert: 8. Platz bei Dreier-Versuchen, 4. Platz bei Dreier-Treffern. Allen und O’Neale zählen ligaweit zu den Top-10-Spielern in erzielten Dreiern, was Phoenix eine neue Offensivdimension verleiht.
Der vielleicht größte Qualitätsgewinn liegt jedoch im Rebounding. Während die Suns im Vorjahr auf Platz 26 bei Offensivrebounds lagen, rangieren sie nun auf Platz 7. Das Erfolgsrezept: Athletik. Spieler wie Richards, Williams, Goodwin und Dunn bringen eine physische Präsenz, die das Team zuvor nicht hatte. Alle vier bringen starke Offensivreboundquoten. Die Folge: mehr zweite und dritte Chancen, trotz identischer effektiver Feldwurfquote wie im Vorjahr (Platz 6).
Im Zentrum des Erfolgs steht Devin Booker, der nach einem schwächeren Jahr beeindruckend zurück ist. Nach Zahlen hat er mit 398 die zweitmeisten Punkte in der Western Conference (nur hinter Shai Gilgeous-Alexander), außerdem legt er Karrierebestwerte bei Assist-Quote (32,2 %) und potenziellen Assists (14,4) auf.
Auch Dillon Brooks spielt eine Schlüsselrolle. Trotz seines Rufes als Provokateur und seiner Playoff-Abwesenheiten bringt er Elemente, von denen Phoenix enorm profitiert: Seine Teams gehörten in drei der letzten vier Jahre zu den besten im Westen, seine Mentalität stärkt die Suns-Defense (von Platz 28 auf Platz 13) und offensiv liefert er mit 22 Punkten im Schnitt wichtige Entlastung für Booker. Er ist wohl der beste Komplementär-Forward, den Booker seit Mikal Bridges an seiner Seite hatte.
Schwachstellen bleiben – und sie könnten entscheidend werden
So stark Phoenix gestartet ist, das Team bleibt verwundbar: Phoenix besitzt keinen zweiten echten Playmaker neben Devin Booker. Der 29-Jährige hat die zweitmeisten Minuten in der NBA, weil das Offensivsystem ohne ihn ins Stocken gerät. Außerdem kommen die Suns trotz starker Schützen kaum zum Korb: 27. Platz bei Freiwürfen pro Spiel, 27. Platz bei Punkten in der Zone.
Treffen die Schützen nicht, kann die Offense schnell einbrechen – sichtbar zuletzt beim Breakdown im Schlussviertel gegen Atlanta.
Die Phoenix Suns sind deutlich besser, ausgeglichener und klarer strukturiert als im Vorjahr. Ein starkes Fundament aus Athletik, Defense, Rebounding und Shooting stützt den herausragenden Devin Booker. Doch ohne zweiten Creator und ohne zuverlässige Rim-Angriffe werden Phoenix’ Ambitionen begrenzt bleiben, zumindest gegen Spitzenteams.