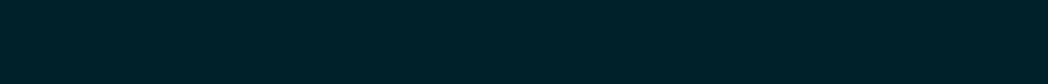Was ist der Video Assistant Referee und warum gibt es ihn?
Der Video Assistant Referee (VAR), auch bekannt als Videoschiedsrichter, ist eine technische Unterstützung für den Hauptschiedsrichter auf dem Spielfeld. Ziel ist es, offensichtliche Fehlentscheidungen in entscheidenden Spielsituationen zu korrigieren. Der VAR soll die Fairness im Fußball erhöhen und sicherstellen, dass gravierende Fehlurteile – wie nicht gegebene Tore oder fälschlich verhängte Platzverweise – vermieden werden.
Der VAR greift nur bei sogenannten "klaren und offensichtlichen Fehlern" in vier klar definierten Situationen ein: bei Toren, Strafstoßentscheidungen, Roten Karten (nicht Gelb-Rot) und bei der Identitätsverwechslung eines Spielers.
Seit wann ist der VAR in der Bundesliga aktiv?
In der Bundesliga wird der VAR seit der Saison 2017/18 regulär eingesetzt. Zuvor gab es in der Saison 2016/17 bereits umfangreiche Tests ohne Einfluss auf den Spielverlauf. Die Einführung erfolgte im Rahmen eines FIFA-Pilotprojekts, das weltweit in mehreren Ligen erprobt wurde. Deutschland zählte zu den Vorreitern in der praktischen Umsetzung.
Wie arbeitet der VAR in der Bundesliga?
Die Video-Assistenten sitzen nicht im Stadion, sondern im sogenannten "Kölner Keller" – dem Video-Assist-Center der DFL in Köln. Von dort aus haben sie Zugriff auf sämtliche Kamerabilder der Live-Übertragung und können jede relevante Szene aus verschiedenen Perspektiven analysieren.
Bei einem Verdacht auf eine Fehlentscheidung funkt der VAR den Schiedsrichter auf dem Feld an. Der Spielleiter kann dann entweder seine Entscheidung ändern oder sich die Szene an einem Monitor am Spielfeldrand nochmals selbst anschauen – das sogenannte "On-Field Review".
Entscheidend ist: Der VAR trifft keine eigenen Entscheidungen, sondern unterstützt lediglich den Schiedsrichter bei dessen Urteilsfindung.
Wer sind die Schiedsrichter im VAR-Raum?
Die VARs sind ausgebildete und erfahrene Schiedsrichter, die oft selbst Bundesliga-Partien geleitet haben oder noch aktiv sind. Es gibt klare Anforderungen: Um als VAR tätig zu sein, müssen die Schiedsrichter eine spezielle Schulung durchlaufen und regelmäßige Fortbildungen absolvieren.
Unterstützt werden sie von sogenannten AVARs (Assistant Video Assistant Referees) und Replay-Operatoren, die für die technische Umsetzung und das schnelle Abrufen der TV-Bilder zuständig sind.
Wie läuft die Kommunikation zwischen Schiedsrichter und VAR?
Die Kommunikation erfolgt über ein verschlüsseltes Funksystem. Sobald der VAR eine Szene überprüft, teilt er dem Schiedsrichter dies mit – meist mit dem Hinweis "Check läuft". Sollte sich im Verlauf des Checks ein klarer Fehler zeigen, empfiehlt der VAR dem Schiedsrichter eine Überprüfung der Szene am Monitor.
Der Dialog ist dabei präzise, professionell und strikt reglementiert. In einigen Ländern wie den Niederlanden oder Australien werden diese Gespräche teilweise öffentlich gemacht – in Deutschland jedoch bisher nicht.
Was verdient ein VAR in Deutschland
Die Bezahlung der VARs ist in Deutschland vergleichbar mit den Honoraren für aktive Schiedsrichter, wenn auch leicht darunter. Pro Einsatz als Video-Assistent erhalten sie rund 1.500 bis 2.000 Euro, je nach Wettbewerb und Erfahrungsstatus. Zusätzlich gibt es Pauschalen für Schulungen und Weiterbildungen. Der Beruf des VAR ist jedoch – wie das Schiedsrichterwesen in Deutschland insgesamt – keine Vollzeitstelle.
Haben alle europäischen Ligen den VAR?
Inzwischen nutzen fast alle großen europäischen Topligen den VAR – darunter die Premier League (England), La Liga (Spanien), Serie A (Italien) und Ligue 1 (Frankreich). Die UEFA setzt ihn bei internationalen Wettbewerben wie der Champions League, Europa League und EM ein.
Allerdings gibt es auch Unterschiede: Während in einigen Ligen der VAR sehr zurückhaltend eingesetzt wird, wie zu Beginn in der englischen Premier League, ist in anderen Ländern die Eingriffsfrequenz höher. Kleinere europäische Ligen wie Schweden arbeiten teils noch ohne VAR, meist aus Kostengründen oder wegen fehlender Infrastruktur.