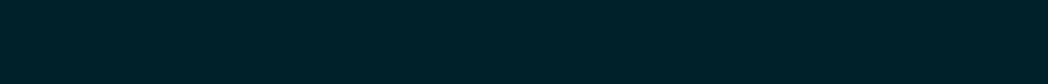Ja, in der Conference League ist man ins Halbfinale eingezogen. Ja, das Rückspiel gegen Legia Warschau war nach dem deutlich gewonnenen Hinspiel mehr oder weniger irrelevant, sodass auch die eher peinliche Niederlage vor heimischer Kulisse verschmerzbar ist. Aber trotz des glücklichen Siegs gegen Stadtrivale Fulham am Sonntag werden die Unterschiede zwischen Anspruch und Wirklichkeit bei den Blues in letzter Zeit immer öfter offensichtlich.
Enzo Maresca, einst Schüler von Pep Guardiola, liebt das kontrollierte Aufbauspiel aus der Tiefe. Chelsea-Fans hingegen? Die wollen Drama, Tempo, Tore – am besten alles gleichzeitig. Der Mann an der Seitenlinie spricht von Strukturen, Korridoren und Sequenzen, während die Tribüne eigentlich nur wissen will, warum der talentierte Noni Madueke nicht einfach seinen Gegenspieler schwindlig dribbelt.
Seine Vorstellung von Fußball ähnelt dem Versuch, neuronale Impulse zu kontrollieren – als könne man mit 721 Pässen pro Spiel die Komplexität des Lebens durch algorithmische Ordnung bändigen. Doch wie das mit Gehirnen nun mal so ist: Irgendwann rebelliert selbst der kleinste Nerv. Oder eben Tosin Adarabioyo, wenn er plötzlich wieder Mensch statt System-Bestandteil ist - und Fehler macht.
Ironischerweise wirbt der Klub derweil mit einem aufwendig betitelten PR-Artikel: „Enzo Maresca: ‚Fußball gehört den Fans‘“. Ein schöner Satz, der jedoch schon im ersten Absatz einem „aber“ weichen muss. Fußball ist komplizierter, sagen sie. Was sie nicht sagen: Die Fans sollen bitte aufhören zu meckern und einfach mitmachen, auch wenn sie keine Ahnung haben, warum Levi Colwill jetzt plötzlich als tiefer Spielmacher fungiert.
Ballbesitz-Fußball als Übel?
Diese Kluft ist kein kleines Missverständnis, es ist eine ideologische Kollision. Auf der einen Seite: Maresca, der Fußballprofessor, der in Gedankenruhe über Dingen schwebt, die andere nicht einmal begreifen können. Auf der anderen Seite: Ein Stadion voller Menschen, die sich fragen, warum das alles wie eine Vorlesung über Statistik aussieht, während sie eigentlich gekommen sind, um ein Rockkonzert zu erleben.
Maresca steht dabei auch sinnbildlich für einen größeren Trend im modernen Fußball: Die Technokraten übernehmen. Der Ballbesitz-Fußball hat sich von Pep Guardiola ausgehend durch Europa gefressen wie ein philosophischer Virus – inzwischen weitgehend ohne Geschmack. Chelsea ist in dieser Hinsicht ein besonders frappierendes Beispiel. Ein Klub, der früher für fußballerisches Chaos, Glanz und Krawall stand, ist nun Spielwiese für einen Trainer, der das Offensivspiel lieber in Tabellenform als auf dem Rasen sieht.

Es bleibt die Frage: Wie konnte ausgerechnet Chelsea, dieser traditionsreiche Adrenalin-Klub, auf die Idee kommen, einen Fußball-Puristen zu holen, der ideologisch näher an Kant als an Kanté ist? Es ist ein bisschen, als hätte man beschlossen, in einem Nachtclub klassische Musik zu spielen.
Aber vielleicht liegt genau darin die Faszination. Chelsea ist derzeit ein soziales Experiment unter Flutlicht. Ein Ort, an dem sich zeigen wird, ob der moderne Fußball auf Top-Niveau auch weitgehend ohne Emotionalität auskommt.
In der Fanszene der Blues hingegen brodelt es. Man sehnt sich auf dem Platz nach dynamischem Offensivspiel, Risiko und brillanten Einzelleistungen. Doch nach aktuellem Stand wird es diese unter dem aktuellen Trainer nicht geben. Bis sich dieses Paradoxon auflöst, bleibt Chelsea unter Maresca ein Klub auf Identitätssuche.