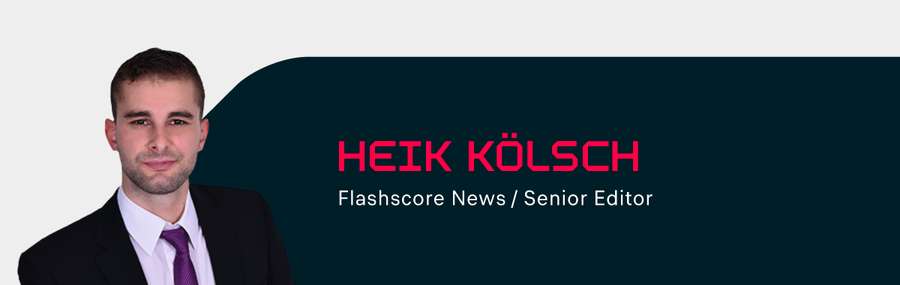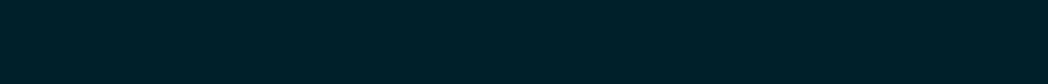Schneller, Steiler, Spektakulärer. Wenn Sportfans an Spannung und Radsport denken, so scheiden sich die Geister. Langweilig und monoton sagen die einen, atemberaubend und inspirierend die anderen. Auf jeden Fall entdeckt sich das Fahren auf vier Rädern in den letzten Jahren ein wenig neu.
Schneller, Steiler, Spektakulärer - der Radport der Zukunft
Pompöse Ankunft des Giro d'Italia in Rom oder Tour-de-France-Ausflug über skandinavische Meeresbrücken nach Dänemark mit Tausenden von begeisterten Fans: Die Aufmachung der großen Rennen werden in den vergangenen Jahren kreativer - der Radsport tritt in die Fußstapfen anderer Sportarten und wird zum Spektakel.
Gleichzeitig wird die Routenführung immer extremer. Man will den Zuschauer bei Laune halten. So bauen die Rundfahrten immer zahlreicher längere und brutalere Bergpässe in ihre Touren ein. Der Altu de L'Angliru, immer regelmäßiger im Programm der Vuelta a Espana, verläuft beispielsweise über 16 lange Kilometer und beinhaltet Passagen mit über 23 Prozent Steigung.
Bei der Tour de France 2023 müssen die Fahrer über 55.000 Höhenmeter klettern: die höchste Zahl in den letzten 25 Jahren. Ohne Frage will der Veranstalter die Tour attraktiver für die Zuschauer machen.
Zu guter Letzt entwickeln sich auch die Fahrer selbst und erfinden das Rennen um Zeit teilweise neu: Haben ein Lance Armstrong und Jan Ullrich um die Jahrtausendwende noch brav bis zu den höchsten Gipfeln gewartet, bis attackiert wurde, sehen wir heutzutage nicht selten bereits in mittelschweren Etappen Kämpfe um wichtige Sekunden.
Gerade Fahrer wie Tadej Pogacar oder Jonas Vingegaard, Vorzeigebilder und Dominatoren des Sports im Jahr 2023, sind dafür bekannt, auch vor Attacken im Mittelgebirge nicht zurückzuschrecken.
Die Gefahren im Radsport
Alles gut und schön - es dient der Unterhaltung der Fans, und macht den Sport, der sich nach einem jahrzehntelangen Doping-Tief immer weiter erholt, attraktiver. Vor allem die letzten beiden Punkte bergen jedoch Gefahren, die in der Tour de Suisse auf eine Art und Weise aufgedeckt wurden, die niemand sehen möchte: weder Fan noch Teams oder Veranstalter.
Denn steiler den Berg hinauf heißt auch steiler den Berg hinab. Immer schneller bedeutet, dass jede Sekunde zählt und die Fahrer gezwungen sind, ins Risiko zu gehen. Ein Risiko, das teilweise in den roten Bereich überläuft. Und wenn das einmal schiefgeht, kann es eben böse enden.
Evenepoel haut auf den Tisch - Mäder kein Einzelfall
"Ich hoffe, dass das heutige Finale der Etappe sowohl für die Organisatoren als auch für uns selbst als Fahrer ein Denkanstoß ist", beschwerte sich Remco Evenepoel, Vuelta-Sieger 2022, nach dem Sturz von Gino Mäder. Eine Bergankunft wäre "problemlos möglich gewesen" und es sei "keine gute Entscheidung" gewesen, die Fahrer noch zusätzlich in die "gefährliche Abfahrt" zu schicken.
Eine Aussage, die tief blicken lässt. Nämlich, dass einige Fahrer es satthaben, in einen Bereich zu gehen, bei dem die Gesundheit, ja gar das Leben auf dem Spiel steht, um konkurrenzfähig zu bleiben.
Denn Gino Mäder ist kein Einzelfall. In der jüngeren Vergangenheit ließen auch Antoine Demoitie, der 2016 mit einem Begleitmotorrad kollidierte, und Bjorg Lambrecht, der 2019 bei der Polen-Rundfahrt stürzte, ihr Leben.
Rolf Aldag fordert Maßnahmen
Ein Trend, der im besten Fall sofort gestoppt werden muss - anders als die Tour de Suisse, die trotz allem fortgesetzt wurde. Zwar mit Einschränkungen und Kürzungen, doch auch wieder mit Show, Spektakel und vor allem Floskeln der Veranstalter, die man als Fan nur schwer akzeptieren kann.
Doch was sind die Alternativen? Rolf Aldag, Ex-Profi und Sportlicher Leiter bei Bora-hansgrohe, fordert "Reflektieren", und dass sich "Teams, Veranstalter und Sportler an einen Tisch" setzen. Sicherlich ein vernünftiger Vorschlag, der jedoch nicht konkretisiert, was genau getan werden kann.
Sollte man steile Abfahrten unmittelbar vor dem Ziel streichen?
Doch was würde tatsächlich Sinn machen? Das Streichen der steilen Abfahrten hin zu Zielorten? Zwar schwer vorstellbar, hat es sich doch als strategisches Mittel erwiesen, Konkurrenten abzuhängen und Zeit gut zumachen, oder gar Etappen für sich zu entscheiden. Hinzu bieten sich kooperierende Städte und Orte als perfekte Veranstalter für Etappenankünfte an. Dennoch darf man diese Möglichkeit keinesfalls ausschließen, da eben genau solche Abfahrten die Fahrer zu deutlich risikoreicheren Manövern zwingen.
Nun haben sich einige Fahrer auf das "Abfahren" spezialisiert, freuen sich in sportlichem Sinne auf diese Bereiche und nutzen sie regelmäßig, um anzugreifen und Zeit zu gewinnen. Auch ist dies mit zusätzlicher Spannung verbunden. Als Fan freue ich mich nicht mehr nur auf die Duelle und Angriffe in den steilsten Passagen vor dem Berggipfel, sondern blicke auch gebannt auf die Vogelperspektive, wenn es eben hinab geht. Wer gewinnt ein paar Meter, reißt eine Lücke, hängt Konkurrenten in der Gesamtwertung ab?
Eine knifflige Debatte, die geführt werden muss.
Auf ein ähnliches Ergebnis würde eine Art "Nicht-Angriffs-Codex" kommen. Zwar würde er die Fahrer schützen. Jedoch würde hier, genau wie beim Streichen der Etappen, der Wettkampf verloren gehen.
Abfahrten sicherer gestalten: Weitere Ideen aus der Flashscore-Redaktion
Würde es die Sicherheit erhöhen, Zäune entlang der Straßen aufzustellen? Sicherlich eine Option, um die Gefahr an Bergpässen zu verringern, gänzlich minimieren werden sie das Risiko aber natürlich nicht. Zudem könnte es sich äußerst aufwendig in der Organisation und Umsetzung gestalten. Wie sehr würden solche Zäune bei den hohen Geschwindigkeiten der Fahrer überhaupt helfen? Meiner Meinung nach könnte dies immerhin als Mindestmaßnahme etabliert werden.
Wie sähe es mit weiteren Maßnahmen wie einer Auto-Brems-Funktion aus, die die Maximalgeschwindigkeit der Fahrer begrenzt? Dies würde meiner Meinung nach einen technischen Speilraum für gute Abfahrer zulassen, und gleichzeitig das Risiko in den Abfahrten eindämmen. Auch könnte ich mir vorstellen, dass man Straßenschilder mit Geschwindigkeitsbegrenzungen anbringt, die vorher auf Basis der Kurvenform und Befahrbarkeit der Strecke von Experten ausgemessen wird. Bei Überschreitung dieser Geschwindigkeit kann es dann zu empfindlichen Strafen kommen.
Womit auch immer die UCI gemeinsam mit den Rennveranstaltern, Teams und Fahrern am Ende um die Ecke kommt - wir sind gespannt.