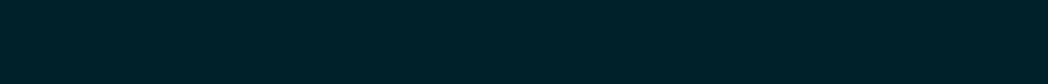Boris Becker hat nach Jahrzehnten im Rampenlicht viel über Diplomatie gelernt. Auf die Frage nach dem Zustand des deutschen Männertennis sagt der ewige Leimener deshalb: "Wir haben großes Glück, einen Spieler zu haben, der realistische Chancen besitzt, einen Grand Slam zu gewinnen." Aber hinter Alexander Zverev sieht Becker schon "eine kleine Lücke".
Falsch ist diese Einschätzung nicht. Nur eben: diplomatisch. Oder undiplomatisch: gnadenlos untertrieben. Denn wenn am Sonntag die French Open beginnen, ist Zverev wieder einmal deutscher Alleinunterhalter. Hinter dem noch bei Grand Slams titellosen Topstar hat sich keine kleine, sondern eine gewaltige Kluft aufgetan.

"Es ist natürlich nicht schön, dass wir da nur einen Spieler haben", sagt Eurosport-Experte Becker. Für den deutschen Rest, Männer wie Frauen, wäre jede überstandene Runde schon ein Erfolg – zumal auf die deutsche Nummer zwei Daniel Altmaier in US-Open-Finalist Taylor Fritz gleich eine riesige Auftakthürde wartet.
Struff kritisch: "Es zählt immer nur die Nummer eins"
Jan-Lennard Struff, weit aus den Top 30 abgerutscht, kämpft laut Becker mittlerweile "mehr mit sich als mit den Gegnern." Bei den Frauen ist nach der Kerber-Ära gar "eine große Lücke entstanden", sagt Becker: "Wir haben Eva Lys, die steht aber noch am Anfang."

Sechs Deutsche, die sich über die Weltrangliste für die Hauptfelder qualifizierten - bedenklich wenig. "Dabei ist Tennis wieder sehr populär in Deutschland", sagt Becker. Einem Boom-Land wie Italien, das neben Topstar Jannik Sinner neun weitere Männer direkt ins Hauptfeld brachte, hecheln die Deutschen aber hinterher.
Woran liegt also der starke Fokus auf Alexander Zverev? Eta an einer medialen Wohlstandsverwahrlosung, wie Struff diagnostiziert? "Ich habe das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft immer nur die Nummer eins zählt", sagte dieser bei web.de.
Zverev – und dann lange nichts
Zverev ist Nummer drei der Welt – an Aufmerksamkeit fehlt es ihm sicher nicht. Und die deutsche Nummer zwei oder drei? Stand einst mehr im Fokus. Damals, als sie, als sie Steeb, Jelen oder Goellner hießen. Sie standen für Erfolg – bekanntlich das zentrale Verkaufsargument.
Vor allem solche bei Grand Slams, wo die TV-Gemeinde ihre Idole länger als eine Woche begleiten darf. Da allerdings hat die Generation Struff wenig zu bieten.
Im vergangenen Jahrzehnt gab es bei den Männern nur einen deutschen Major-Viertelfinalisten, der nicht Zverev hieß – und der hieß Zverev: Alexanders Bruder Mischa reüssierte 2017 in Melbourne. Struff selbst scheiterte bei 41 Grand-Slam-Teilnahmen 25-mal in Runde eins und siebenmal in Runde zwei, lediglich zweimal erreichte er ein Achtelfinale.

Die guten, alten Zeiten
Sogar nach Beckers Zenit reichte es für deutsche Männer – auch aus zweiter und dritter Reihe – in schöner Regelmäßigkeit für Viertelfinalbesuche. Die Knippschilds, Dreekmanns, Radulescus erhielten ihre eineinhalb Wochen Ruhm.
Noch 2012 standen in Wimbledon zwei Deutsche – Philipp Kohlschreiber und Florian Mayer – unter den Top acht. Bei den Frauen liegt eine solche Hochphase kürzer zurück: 2022 gewann Tatjana Maria im Wimbledon-Viertelfinale gegen Jule Niemeier.
Zverev rausgerechnet, sind solche Ergebnisse nun utopisch. "Ich hoffe, bald ändert sich etwas", sagt Becker. Justin Engel und Diego Dedura, beide 17, könnten etwas ändern. Womöglich irgendwann. "17 ist noch verdammt jung", sagt Becker. Auch er war mal 17, 1985 in Wimbledon. Die Älteren erinnern sich.